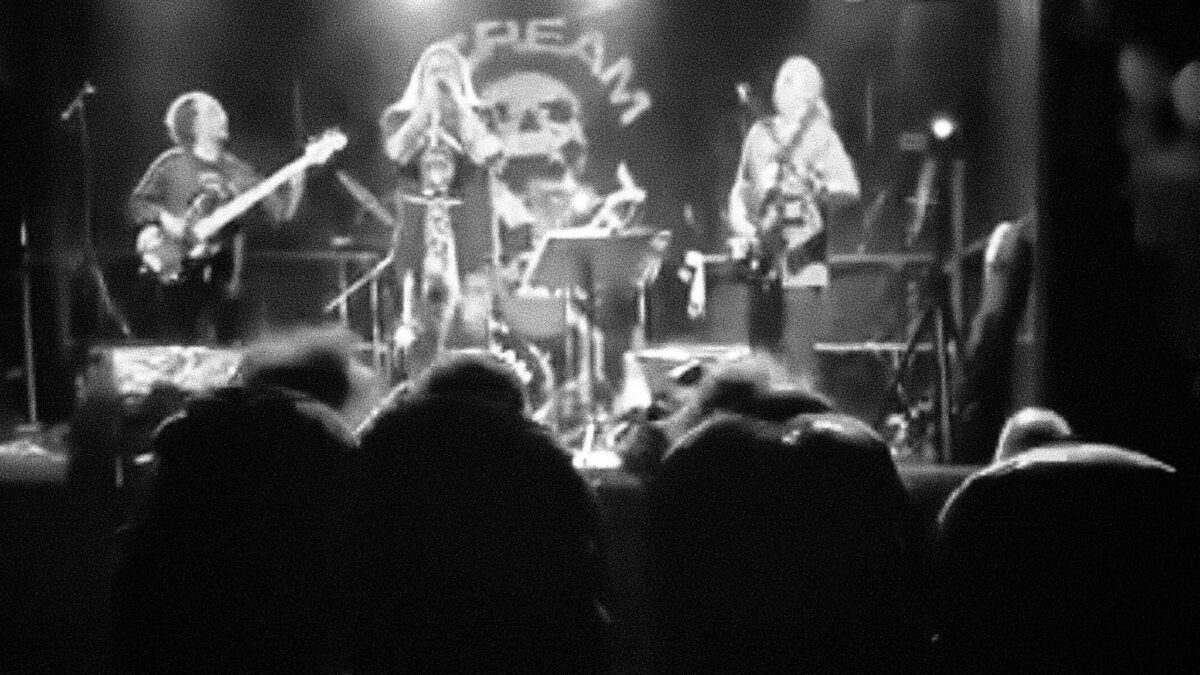Das Fazit vorweggenommen: Ich sehe nichts schlechtes daran, Live-Musik als Hobby zu betreiben, im Gegenteil. Als Band mit Auftritten seinen Lebensunterhalt zu bestreiten ist die letzten Jahre immer schwieriger geworden. Der Markt ist je nach Region stark gesättigt, das Publikum bekommt seinen Live-Kick jedes Wochenende irgendwo – oder dann an einer Party oder im Pub mit YouTube aufm Beamer. Die Pandemie tat ihr übriges, dass der Karriereweg «von Live-Musik leben» für die allermeisten ein Wunschtraum bleibt. Dann trotzdem mit Herzblut und Leidenschaft Musik zu machen und an die Leute zu bringen? Finde ich grossartig!
Begrifflichkeiten: Pro, Semi-pro, Amateur
Amateur soll nicht abwertend klingen. Gemeint ist damit lediglich, dass man seine Auftritte weder als Nebenverdienst (Semi-pro) noch als Hauptverdienst (Pro) versteht. Und da ehrlich zu sich ist und entsprechend handelt. In diesem Beitrag dreht es sich dabei um die Band, nicht deren Mitglieder – in einer Amateur-Band können auch durchaus Berufsmusikerinnen spielen, ein befreundeter Amateur bei einer Semi-pro-Band aushelfen, weil die Gitarristin beim letzten Gig von der Bühne stürzte und nun zwei eingegipste Beine hat.
Pro Live-Musik
Bei einer Pro-Band ist die Band der Arbeitsgeber, die Firma, in der man selbst Gesellschafter oder Angestellter ist. Die Band ist ein Unternehmen, inklusive verschiedener Einkommens-Streams (Live-Gigs, EP/CD, Merch, Meet-and-Greet etc.), Ausgaben und Abschreiber (Equipment, Verbrauchsmaterial, Roadies, Tontechniker*innen, Lizenzen, Versicherungen etc.) sowie Aufgabenbereiche (Live, EP- und Videoclip-Produktion, Stage-Show konzipieren, Kostüme, Deko, neue Songs schreiben etc.).
Viele Pro-Bands spielen nur ihre eigenen Songs. Damit es sich für eine Cover-Band rechnet, ist man oft als Hochzeits- oder Unterhaltungs-Band unterwegs. Man hat ein Repertoire von 150+ Songs aller Stilrichtungen und ist vorwiegend Hintergrundmusik für einen Anlass wie zum Beispiel eine Firmenfeier. Eine menschliche Jukebox, so zu sagen. So an die 70-150 Gigs im Jahr scheint für viele Bands in diesem Umfeld die Norm zu sein.
… oder aber man produziert eben als Originals-Band alle 1-2 Jahre ein neues Album und geht auf die Festival-Rundreise. Dann reichen auch 30-50 Gigs pro Jahr aus, um zusammen mit den anderen Einkommens-Streams davon leben zu können. In der festivalfreien Zeit arbeitet man halt als Studiomusiker*in oder am nächsten eigenen Album.
Semi-pro Live-Musik
Die Band stellt ein Einkommen neben dem Hauptberuf dar. Das heisst, man macht nicht rückwärts, sondern kommt Ende Jahr zumindest auf eine schwarze Null, was Ein/Ausgaben an Zeit, Energie und Geld betrifft. Mittelfristig verdient man aber genug, dass man’s als Nebeneinkommen in die Steuererklärung setzt und Sozialabgaben bezahlt.
Die Musiker*innen solcher Bands werden oft «Weekend-Warriors» genannt, weil sie fast jedes Wochenende irgendwo auftreten – als Cover-Bands in Bars oder als Originals-Band im Vorprogramm für einen (inter)nationalen Act, der in der Region Station macht. Damit es sich rechnet, sind gemäss verschiedener Umfragen wohl um die 30-50 bezahlte Auftritte pro Jahr nötig. Nicht immer ganz leicht, denn sowohl der Hauptberuf als auch Familie und andere Verpflichtungen müssen mitspielen. Und das muss man sich von der Zeit und vom Geld her leisten können. Also heisst das: fast immer Teilzeit-Hauptberuf, oft selbständig statt im Angestelltenverhältnis, verständnisvolles Umfeld.
Amateur Live-Musik
Hier sind die Auftritte ein Hobby. Es wird nicht versucht, damit Geld zu verdienen; ein Hobby kostet in der Regel Geld, egal, ob man im Verein die grösste Modell-Eisenbahn der Nordostschweiz basteln möchte, Felswände hochklettert oder als Cover-Band auftritt. Rechnet man ehrlich, bekommt man nur in Ausnahmefällen wieder etwas monetär zurück. Man darf nicht erwarten, nur schon eine schwarze Null zu schreiben. Wie gesagt: Menschen geben in der Regel Geld für ihre Hobbys aus. Wenn man für Gigs Honorar erhält, ist’s schön, falls sich das Hobby selbst bezahlt. Damit rechnen sollte man aber nicht.
In diesem Bereich finden sich vorwiegend Cover- und, seltener, Originals-Bands, die oft an lokalen/regionalen Festivals auftreten, mal für einen Geburtstag im Freundeskreis oder einfach aus Lust und Laune selbst ein Konzert auf die Beine stellen. Im Gespräch hat sich ergeben, dass 3-10 Auftritte im Jahr als vernünftig erscheinen, je nachdem, was man spielt und vor allem auch, wo man lebt. Denn da ist ja immer auch die Sache mit der Geografie.
Die Sache mit der Geografie
Ein Problem, das viele unbekanntere Bands zu haben scheinen, ist, dass sie ihr Stammpublikum ermüden könnten. Mehr als 2-3x pro Jahr in derselben Ortschaft oder im Falle der kleinräumigen Schweiz im selben Bezirk hat wenig Sinn – egal, wie befreundet man mit der «Heim-Basis» ist, die Leute kommen nicht alle paar Wochen vorbei, nur, um dann dasselbe Set nochmals zu hören.
Das macht die Situation besonders für Semi-pros schwierig. Mit Hauptberuf und Familie im Rücken öfters auch in Deutschland, Österreich und der Westschweiz aufzutreten, damit genug frisches Blut kommt und man die Fan-Base ausbaut? Und dabei genug verdient, dass sich der Aufwand lohnt? Das ist parallel zum Broterwerb eine Herausforderung. Amateure haben es da einfacher, weil sie sowieso weniger Auftritte «brauchen», um das Hobby für sich zu rechtfertigen. Also reichen 1-2x im Jahr daheim und noch 2-3x extern gut aus.
Ehrliches Rechnen, nicht nur für die Finanzen
Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Leser, die eine oder andere Leserin oben beim Semi-pro-Teil ausrief: Hey, meine Band tritt zwar nur ein paar Mal im Jahr auf, aber wir werden bezahlt, also sind wir Semi-pro, nicht Amateure! Vorangestellt: Die Etiketten, die ich hier verwende, haben nichts mit der Qualität oder dem musikalischen Können zu tun. Es geht mir rein um den berufstechnischen Ansatz. Nun denn, würde besagte Leserin vielleicht sagen: Ich sehe mich als Schlagzeugerin, und wir bekommen Kohle, also: Semi-pro! Der Eindruck mag auch tatsächlich zum Selbstbild passen. Aber ich denke, öfters ist es der Fall, dass nicht ehrlich gerechnet wird.
Denn: Sind mit diesem Verdienst z.B. Ersatz-Saiten oder das neue Effektgerät für den Bass bezahlt? Oder die Zweit-Gitarre, die man für die drei Songs auf Eb braucht? Wie sieht es mit Anfahrt zum Übungsraum aus, oder zu den Gigs? Verpflegung unterwegs oder vorort? Die Zeit, die für Proben draufgeht – hat man die, weil man im Hauptjob unbezahlten Urlaub nimmt oder als Selbständige*r Aufträge ausgeschlagen hat? Und ist man nach einem Gig am nächsten Tag als Angestellte*r noch voll arbeitsfähig und hat generell genug Energie für die Partnerschaft und Kinder? Ist das Equipment versichert, und wie sieht es mit Folgekosten für gesundheitliche Gebrechen wie «Rücken», Karpaltunnelsyndrom oder Hörschaden aus? Oh, und die Bandraum-Miete bedacht? Steuern bezahlt?
Die Graukosten gehen gerne vergessen
Semi-pro ist man dann, wenn trotz alledem immer noch ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen besteht. Und ich denke, bei diesen «Graukosten» verrechnen sich oft viele Musikerinnen und Musiker – auf allen Ebenen, nicht nur bei den Semiprofessionellen. Ob Schülerband oder internationaler Top-Act, oft wird sich die Leidenschaft auch schöngerechnet oder man vergisst die Graukosten an Zeit, Geld und Energie. Ein weiteres Problem beim unehrlichen Rechnen besteht darin, dass man sich verschätzen kann und sich, zum Beispiel als Amateur-Band, übernimmt. Man kalkuliert die Kosten, als wäre es ein Hobby, hat aber die Ambition, so viele Auftritte wie jemand zu stemmen, der oder die davon zumindest zum Teil leben muss. Und weil die Graukosten ausgeblendet werden, denkt man zu schnell, dass es funktionieren könnte.
Das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund dafür, dass sich viele ambitionierte Bands nach 2-3 Jahren auflösen. Ein Teil der Band findet diese Graukosten angemessen oder ignoriert sie. So kommt man dann zum Schluss, dass es jetzt an der Zeit für den nächsten Schritt wäre, weil, man verdient ja bereits jetzt Geld, mit mehr Auftritten gibt’s auch mehr Geld, logisch, und dann kann man semiprofessionell auftreten und als Opener mit einem bekannten Act auf Europatour gehen und so weiter. Ein anderer Teil der Band sieht die Belastung fürs familiäre und berufliche Umfeld, den eigenen Energiepegel und kommt zum Schluss: Bei allem Spass, auf der Bühne zu stehen, das Jahreshonorar reicht bei weitem nicht aus, um diese Belastungen gesund auszugleichen. Damit sich besagter «nächste Schritt» lohnt, müssten wir statt 4x im Jahr 30x auftreten, dafür müsste ich aber im Job auf 60 % reduzieren, und das lässt meine Firma nicht zu.
Also – was heisst das denn nun für Amateure?
Wie gesagt – ich mag Amateur-Bands; nicht selten finden sich dort bessere Musiker*innen als bei Pro-Acts, die routiniert und gelangweilt jeden zweiten Abend ihr Set runterspulen. Aber um zur titelgebenden Frage dieses (viel zu langen) Beitrags zu kommen – wie oft ist zu oft, oder nicht oft genug, um als (Cover-)Band gut unterwegs zu sein?
Eine Faustregel, die ich vor einiger Zeit gehört und für gut befunden habe, lautet: Ein Auftritt entspricht in Sachen Zeit und Energie sechs Bandproben, und umgekehrt. Probt die Band üblicherweise zwei Mal im Monat, entsprächen diese Proben vier Live-Gigs; da man sich aber mit Proben auf diese Gigs vorbereiten sollte, wären 2-3 Auftritte im Jahr angemessen. Probt man wöchentlich, 4-6 Auftritte im Jahr; wer sich ein Mal im Quartal trifft, kann sich sicher einen kleineren Auftritt im Jahr erlauben. Und hey, das ist nicht Nichts, sondern spielt der Band gegebenenfalls sogar in die Hände. Denn jedes Konzert wird so zum Anlass, zum Event. Die Fanbasis freut sich, die Band endlich mal wieder live zu sehen. Und sagt sich nicht: Och, die treten eh alle paar Wochen live auf, ich guck lieber nächsten Monat mal rein. Heute ist das Wetter zu schön und ich will grillieren.
Würde Metallica jedes Mal das Hallenstadium füllen, wenn die Band 12x im Jahr in der Schweiz wäre? Eben.